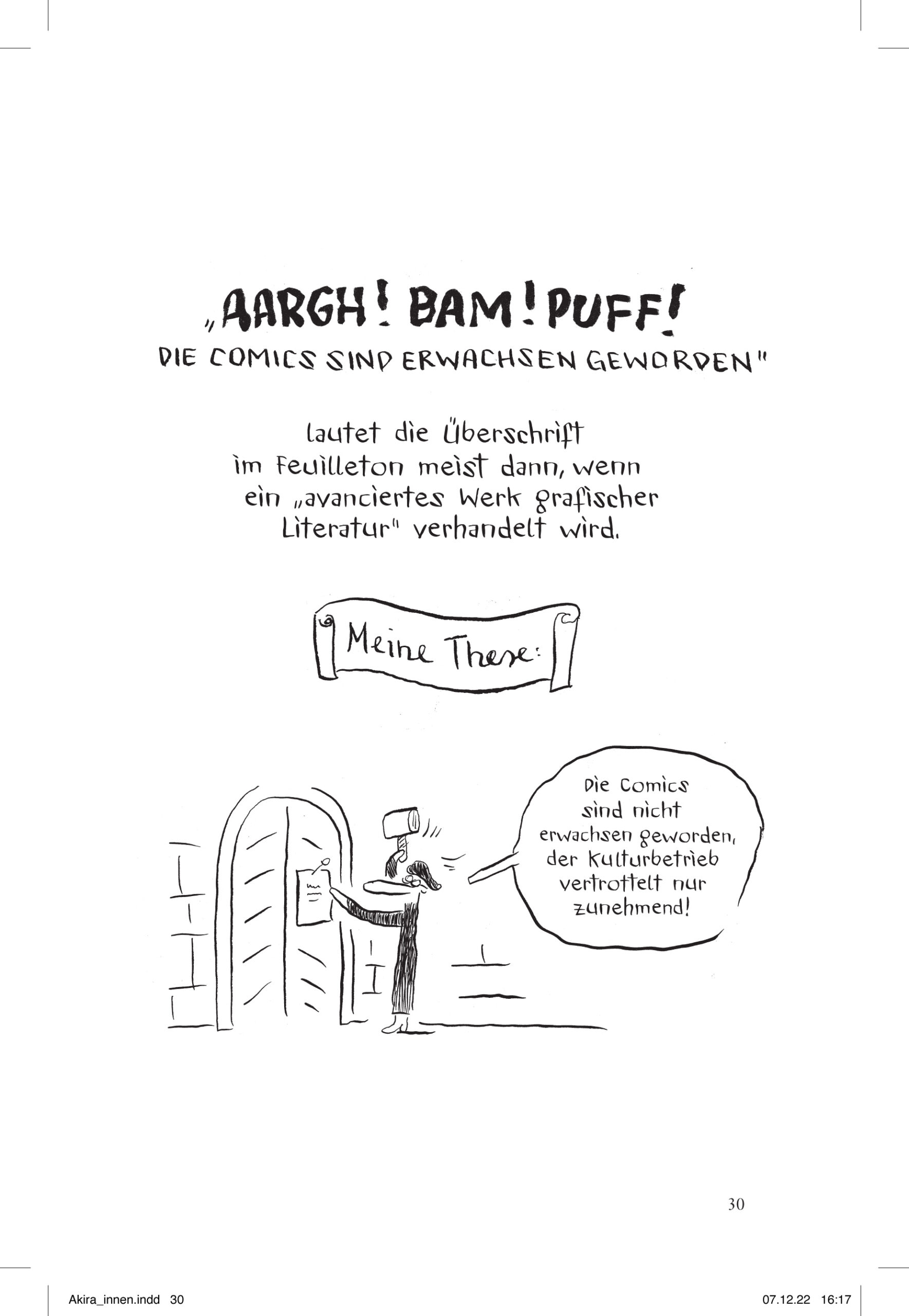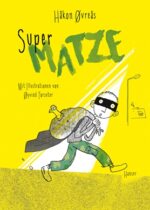Das Wertvollste überhaupt
ist das total Sinnlose
zum Artikel im Eselsohr, August 2023…
Nicolas Mahler (*1969) ist ein Wiener Comiczeichner
und Illustrator. Sein Werk wurde
vielfach ausgezeichnet, u. a. erhielt er
2010 den Max und Moritz-Preis als „Bester
deutschsprachiger Comickünstler“. Seine
Comics und Cartoons erscheinen auch in der
Titanic, der NZZ am Sonntag oder der FAZ. Im
Februar erschien sein jüngstes Werk: Akira
Kurosawa und der meditierende Frosch. Ruth
Rousselange sprach mit ihm fürs Eselsohr.
War es damals für Sie auch eine Genugtuung,
von den Lehrern der Kunsthochschule abgelehnt
zu werden? So was kann ja befreiend
sein.
Eine Genugtuung, weil man abgelehnt wird
(lacht), das habe ich ja noch nie gehört. Das
wäre, glaube ich, eine Selbstlüge. Ich habe zu
der Zeit so viele Ablehnungen bekommen, dass
das eigentlich normal war. Wenn ich zurückblicke,
hat’s mich nicht so getroffen, ich bin
von nichts anderem ausgegangen. Das kann
man sich nachher schönreden und sagen, wenn
sie mich damals genommen hätten, wäre alles
ganz anders gekommen und vielleicht hätte
ich nicht so viele eigene Sachen gemacht. Aber
währenddessen ist es einfach nur negativ.
Im Laufe der Jahre hat sich alles sehr positiv
entwickelt. Sie sind ja im Kulturbetrieb elementar
angekommen.
Na ja, es war aber nicht so schnell positiv. Ich
wäre ein recht später Student gewesen. 1992
wollte ich auf die Kunsthochschule, da war ich
22 Jahre. Und von 23 bis 33 war es eine Durststrecke.
Es gab trotzdem immer gerade genug
an Ermutigung, der kleine Job in der Videothek,
irgendwer hat meine Sachen gesehen, dann hat
man wieder gehofft. Aber alles lief auf sehr
kleiner Flamme. Wenn man keine Ausbildung
hat, etwas einfach so anfängt, kommt einem
das nicht so komisch vor. Ich glaube, es ist viel
schwieriger, wenn man das Metier studiert hat
und dann rauskommt und glaubt, die Welt hätte
auf einen gewartet. Von Anfang an habe ich gewusst,
auf mich wartet sicher niemand.
Wie sieht es inzwischen mit Ihrer Auflagenhöhe
aus?
Das ist ganz unterschiedlich, je nach Buch, in
paar Tausend halt, dann wird nachgedruckt,
wenn’s gut geht. Ich hab‘ so ein Kreativausmalbuch
bei Suhrkamp gemacht, Das kleine Einschlafbuch
für Große, das hat natürlich eine
höhere Auflage als der Ulysses. (beide: Suhrkamp,
2016 + 2020).
Da sieht man’s mal. Joyce, Musil, Proust, wie
sind Sie zu den Klassikerinterpretationen gekommen?
Schon davor habe ich gerne mit bereits vorhandenen
Texten gearbeitet, dann ist diese Anfrage
von Suhrkamp gekommen. Sie möchten eine
Reihe mit gezeichneten Klassikern machen. Da
habe ich mir den Bernhard gewünscht. Der ist
gut angekommen, ich habe im Verlagsprogramm
gestöbert und bin weiter fündig geworden. Ich
mach das sehr gerne, es gibt mir Inspiration.
Sarkastisch und lakonisch wirken Ihre Comics.
Humor ist das, sarkastisch würde ich ihn nicht
nennen, eher illusionslos. Wobei das eher die
Weltsicht ist, auf der das Ganze fußt, weder
träumerisch noch niedermachend. Bösartig,
spöttisch finde ich meinen Humor nicht. Was
ich mache, sind kühle Beobachtungen, nicht
groß wertend, ohne Bitternis. Meine Figuren
sind nicht unsympathisch oder böse, sie sind
vielleicht niedergeschlagen, machen aber
trotzdem weiter. So richtig lebenslustige, positive
Menschen ohne Probleme, die können mit
meinen Sachen nix anfangen.
War ihr Stil von jeher so minimalistisch?
Der hat sich entwickelt, ich wollte ja richtiger
Comiczeichner werden, für Fix & Foxi, da war
ich aber nicht gut genug. Jetzt kann ich ja sagen,
für Fix & Foxi zu schlecht und für Suhrkamp
reicht’s (lacht sehr). Das normale Comiczeichnen
ist mir nicht gelungen, ich hab’s aber lange
probiert, dann hab ich gemerkt, nein, das
ist einfach zu anstrengend, das macht keinen
Spaß. Dann habe ich mehr einen Cartoon- als
einen Comicstil entwickelt, inspiriert von den
1960ern, von Franzosen wie Chaval. Ich wollte
auch einfach schneller sein, weil mich das fertiggemacht
hat, so lange an einer Seite zu sitzen.
Außerdem kann man mit einem einfachen
Stil viel blödere Witze machen.
Haben Sie als Kind Comichelden bewundert?
Ende der 1970er habe ich Hefte gelesen, die
es in der Trafik gegeben hat. Das war der Kiosk
mit Zigaretten, Zeitungen und den gängigsten
Comicheften, die waren nix Besonderes, aber
normal, dass man sowas liest. Asterix lustigerweise,
war mir immer zu langweilig, zu bieder.
Schon als Kind habe ich gemerkt, das mögen
sogar die Lehrer, das kann nichts sein (wieder
Lachen). Für mich ist bis heute das ärgste
Warnsignal „empfohlen von Lehrern und Pädagogen“.
Da lernt man auch was, das habe ich
schon als Kind total abstoßend gefunden.
Gefühlsmäßig war der Comickonsum etwas, das
war abgekoppelt vom Nützlichen. Es ist lustig,
wie wenig man sich im Kern ändert. Bis heute
finde ich, das Wertvollste überhaupt ist das
total Sinnlose. Vielleicht ist das ein Ausgleich
zum Alltag, wo alles immer abgewogen werden
muss, da braucht man was völlig Sinnloses, um
das Spektrum der Existenz auszukosten.
Vielen Dank für das Gespräch.